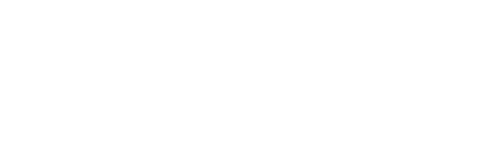Kaum eine Frage von langfristiger Bedeutung ist derzeit wichtiger – auch wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung von akuten geopolitischen Schlagzeilen überlagert wird – als die Debatte um den künftigen Kurs der US-Geldpolitik, betont Harald Holzer, CIO bei der Kathrein Privatbank. Während sich die Welt auf Kriege, Handelskonflikte oder Wahlen konzentriert, wird in Washington ein Thema diskutiert, das die Grundlage unserer Finanzwelt berührt: Soll Jerome Powell vorzeitig als Vorsitzender der US-Notenbank abgelöst werden, um eine lockerere Zinspolitik durchzusetzen?
Hinter dieser Personalie steht ein tieferliegendes Spannungsfeld: Seit der Gründung moderner Zentralbanken ringen Politik und Geldpolitik um Einfluss und Unabhängigkeit. Regierungen bevorzugen traditionell niedrige Zinsen – sie erleichtern die Finanzierung wachsender Haushaltsdefizite und stützen das Wachstum. Notenbanken dagegen sind dem Ziel verpflichtet, Preisstabilität und damit den langfristigen Wert des Geldes zu sichern.
ROLLE DER FED
Die Federal Reserve wurde 1913 durch den Federal Reserve Act gegründet, ursprünglich mit der Aufgabe, als Lender of Last Resort zu fungieren. Seit 1977 verfolgt sie ihr berühmtes duales Mandat: Sie soll Preisstabilität wahren und maximale Beschäftigung ermöglichen. Die geldpolitischen Entscheidungen trifft das Federal Open Market Committee (FOMC), dessen Struktur darauf ausgelegt ist, politische Einflussnahme zu begrenzen und Kontinuität zu sichern.
Das FOMC besteht aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern: den sieben Mitgliedern des Board of Governors, die für 14 Jahre ernannt werden, und fünf Präsidenten der zwölf Federal Reserve Banks. Die Präsidenten der Regionalbanken werden von den jeweiligen Aufsichtsräten bestellt. Während die Federal Reserve Bank of New York immer eine Stimme besitzt, wechseln die übrigen elf Distrikte sich jährlich bei den verbleibenden vier Sitzen ab. Dieses Rotationsprinzip und die langen Amtszeiten der Gouverneure dienen dem Schutz vor kurzfristigen politischen Eingriffen und sichern die Unabhängigkeit der Geldpolitik.
Auch wenn der Vorsitzende der Fed im FOMC formal nur eine von zwölf Stimmen hat, ist seine Bedeutung nicht zu unterschätzen. Der Vorsitzende steuert die Sitzungen, prägt die geldpolitische Strategie und spricht für das gesamte Komitee nach außen. Damit bestimmt er wesentlich, wie die Märkte die US-Geldpolitik wahrnehmen. Gerade in politisch heiklen Zeiten richtet sich der Fokus daher besonders auf die Person an der Spitze der Fed.
TRUMP VS. POWELL
Donald Trump hat Jerome Powell bereits während seiner Präsidentschaft wiederholt öffentlich attackiert, weil dieser seiner Meinung nach die Zinsen „zu hoch“ hielt. Nun deutet Trump an, schon vor Auslaufen der Präsidentschafts-Periode Powells 2026 potenzielle Nachfolger zu benennen, um die Fed zu einem lockereren Kurs zu bewegen. Die Märkte reagierten prompt: Der Dollar gab nach, da Anleger die Unabhängigkeit der Fed in Gefahr sehen und sich vor unvorhersehbaren geldpolitischen Kursänderungen sorgen.
Obwohl der Supreme Court klarstellte, dass ein Fed-Vorsitzender nur unter engen Bedingungen entlassen werden kann, reicht der öffentliche Druck bereits, um die Erwartungen an die Geldpolitik zu verändern. Die Unabhängigkeit der Fed – ein Grundpfeiler stabiler Finanzmärkte – steht auf dem Prüfstand.
Der Bundesetat liefert den Kontext. Das Kongressbüro (CBO) erwartet für das Fiskaljahr 2025 ein Defizit von rund 1,9 Billionen US-Dollar, während das Bipartisan Policy Center (ein überparteiliches Forschungs- und Politikberatungsinstitut) bereits bis Ende Mai ein kumuliertes Minus von 1,4 Billionen US-Dollar ausweist – sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Höhere Zinsen verteuern jeden Dollar Neuverschuldung sofort. Daraus entsteht politischer Druck, die Geldpolitik gefügig zu machen, anstatt auf harte Haushaltsentscheidungen zu setzen.
HISTORISCHE PARALLELEN
Andrew Jackson (1832): Mit dem Veto gegen die Re-Charter der Second Bank of the United States torpedierte er die damalige Zentralbank, weil er sie als „Werkzeug der Eliten“ sah. Der „Bank War“ führte zur Auflösung der Institution und zu finanzieller Instabilität.
Lyndon B. Johnson (1965): Johnson drängte Fed-Chef William McChesney Martin auf Zinssenkungen, um den Vietnamkrieg und Great-Society-Programme zu finanzieren. Berühmt ist das Treffen auf der Ranch in Texas, bei dem Johnson ihn physisch bedrängte.
Richard Nixon (1971–1972): Auf den Mitschnitten aus dem Oval Office ist dokumentiert, wie Nixon Arthur Burns zu einer lockeren Geldpolitik vor der Wahl 1972 drängte: „I respect the independence of the Federal Reserve, but I hope that the Fed will come to see the wisdom of my views.” Die expansive Linie trug zur Großen Inflation der 1970er bei.
Die Erfahrungen zeigen, dass kurzfristig politisch motivierte Zinssenkungen häufig längerfristige Kosten in Form von Inflation oder Finanzinstabilität nach sich ziehen. Erst Paul Volcker brach dieses Muster ab 1979, indem er zweistellige Leitzinsen verordnete, um die Preisspirale zu stoppen.
Empirische Studien belegen, dass Länder mit unabhängigen Notenbanken tendenziell niedrigere und stabilere Inflationsraten haben, ohne beim Wachstum zurückzufallen. Unabhängigkeit senkt die Risikoprämie, weil Marktteilnehmer erwarten, dass Geldwertstabilität Vorrang vor parteipolitischen Zielen hat. In einem Umfeld strukturell höherer Staatsdefizite ist diese Glaubwürdigkeit doppelt wichtig, da sie das Vertrauen in Staatsanleihen schützt.
KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Selbst ein neuer Fed-Chair kann die ökonomischen Grundgrößen nicht ignorieren. Demografiebedingter Arbeitskräftemangel, hohe Verteidigungsausgaben und die Transformation zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft halten den Ausgabendruck hoch. Gleichzeitig untergräbt ein explodierender Schuldendienst die fiskalische Flexibilität. Sollte die Geldpolitik allein die Last tragen, drohen Zielkonflikte.
Was bedeutet das für unsere Marktstrategie? Zinsrisiko aktiv managen: Wir passen die Duration und das Credit-Exposure flexibel in den Anleihenportfolios an, um Überraschungen einer politisierten Fed abzufedern.
Diversifikation im Rententeil stärken: Wir setzen auf ein breit gestreutes Anleihenportfolio, das in Europa, den USA und den Emerging Markets mehrere Sektoren abdeckt. So lassen sich politische und wirtschaftliche Risiken besser verteilen.
Währungsengagement prüfen: Der US-Dollar könnte weiter an Boden verlieren, wenn sich politische Einflussnahme durchsetzt und die Fed geschwächt wird. Wir setzen hier auf unser bewährtes Währungsmanagement.
Die Diskussion um Jerome Powell zeigt, wie schnell die Grenze zwischen Politik und unabhängiger Geldpolitik ins Wanken geraten kann. Historisch betrachtet endeten solche Eingriffe selten gut. Ein neuer Fed-Vorsitzender wird sich den realen Herausforderungen von Inflation, Wachstum und Schulden nicht entziehen können. Doch schon die Androhung einer politisch motivierten Personalrochade ist ein Warnsignal in einer Zeit, in der das US-Budgetdefizit neue Rekorde erreicht. Für private Anleger bedeutet das: Geldpolitische Risiken sollten ebenso ernst genommen werden wie konjunkturelle.