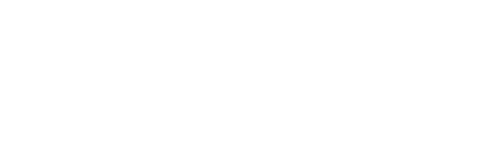Beim Thema Nachhaltigkeit scheint die Wahrnehmung doch stark von Kurzfrist-Aufmerksamkeiten verzerrt zu sein, wie jüngste Medienveröffentlichungen zeigen. Hinzu kommt, dass sich nachhaltige Fonds vermehrt für Waffen-Investments öffnen, um der aktuellen gesellschaftlichen Debatte Rechnung zu tragen, ohne aber auf die vermutlich wirklichen, Performance getriebenen Gründe einzugehen, sondern von der Unterstützung der Verteidigungsfähigkeit unserer Demokratie sprechen, was nicht gerade zur Glaubwürdigkeit dieser Art von Geldanlage beiträgt. Richtig ist, dass Nachhaltigkeit in der Geldanlage schon mal viel attraktiver war und der Eindruck aufkam, es ginge der gesamten Finanzindustrie nur noch darum, mittels des Fokus auf die sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung), die Welt zu verbessern bzw. weniger schlecht zu machen.
Lange fristeten nachhaltige Investments ein Nischendasein. Mit der EU-Regulatorik nahm es vor einigen Jahren Fahrt auf und gipfelte 2021/2022 in Euphorie. Denn seit März’21 musste jeder Investmentfonds nach der EU-Offenlegungsverordnung in Artikel 6, 8 oder 9 eingestuft werden. Das führte zu einer explosionsartigen Schwemme an Fonds, die quasi über Nacht der Nachhaltigkeit zugeordnet wurden. Darunter viele bereits existierende Produkte, die bislang nie als nachhaltig vermarktet wurden, nun aber durch Selbstdeklarierung Nachhaltigkeitsmerkmale in welcher Art auch immer berücksichtigen.
Stieg die Anzahl an in Deutschland vertriebenen Nachhaltigkeitsfonds in den Jahren davor jeweils zwischen zehn und zwanzig Prozent an, so verdreifachte sie sich im Jahr des Inkrafttretens der Offenlegungsverordnung – der Hype war geboren. Bei heute mittlerweile fast 15.000 weltweit existierenden, meist nichtssagenden „Artikel-8-Fonds“ war es eine Frage der Zeit, bis Privatanleger die Orientierung verloren und unabhängige Qualitätseinstufungen, wie zum Beispiel das FNG-Siegel, wichtiger wurden.
Für Privatanleger war es allerdings der August 2022, der durch die Einführung der viel zu verkopften und realitätsfernen Einführung der MiFID-II-Nachhaltigkeitspräferenzabfrage letztendlich eine Zäsur einleitete. Denn die detaillierten Vorstellungen, wie Brüssel Finanzberatern mittels drei konkret vorgegebener Wege vorschreiben möchte, wie Kunden das Thema nähergebracht werden soll, sind viel zu komplex und schüren Angst vor Falschberatung. Selbst Fachleute streiten in Anbetracht der Koexistenz zweier Begriffe einer nachhaltigen Investition und ein durch zu hohe Interpretationsspielräume nicht zielführendes Quoten-Wirrwarr über den richtigen Umgang.
Hinzu kommt bei vielen, die das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage erst kürzlich entdeckten, folgende fatale Koinzidenz: Die Empirie zeigte bis zur Pflicht-Beratung eindeutig, dass es in der Vergangenheit keine Nachteile in Sachen Rendite-Risiko bei nachhaltigen Geldanlagen gab. Von der Wissenschaft gab es also die beste Steilvorlage für den Vertrieb. Mit dem Angriffskrieg von Putins Russland, der damit einhergehenden Energiekrise und des im gleichen Jahr einsetzenden Zinsanstiegs wegen des Inflationsschubs wurde allerdings zumindest bislang die Performance-Zeitenwende eingeleitet. Denn beides machte beliebte Ausschlusskriterien wie Waffen und fossile Energien (im Vergleich zu kapitalintensiven Erneuerbaren) wirtschaftlich attraktiv. Mit Ausnahme von 2023, sind 2022 und 2024 und auch dieses Jahr schlechte Performancejahre für die Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Und obwohl die Geldanlage langfristig ausgerichtet werden soll und auch die Zehn-Jahres-Performance weiterhin für Nachhaltigkeit spricht, ist die konkrete Erfahrung vieler ESG-Neueinsteiger durch die kurzfristig schlechte Performance seit drei Jahren negativ geprägt.
Zum Gesamteindruck gehört aber auch, dass das Gros institutioneller Investoren weiter an ESG festhält und insgesamt die Volumina nachhaltig verwalteter Gelder ansteigen. Bekannt ist auch, dass wir es in puncto Klima & Umwelt mit Physik bzw. Biologie zu tun haben und wir wissen, dass jeder heute nicht ausgegebene Euro morgen um ein Vielfaches teurer sein wird. Das Thema drängt sich also rein aus finanziellen Gründen auf, denn die Grundrechenart des Kapitalmarkts ist weiterhin die Diskontierung zukünftiger Erträge & Aufwände. Die Frage ist, wie der Umgang mit ESG zukünftig in Finanzprodukten ausgestaltet werden wird und ob die Impact-Frage, also die Frage, ob ein Finanzprodukt bzw. ein Investor ökologische und soziale Verbesserungen erzielt, weiter an Bedeutung bei den Produkteigenschaften nachhaltiger Geldanlagen gewinnen wird. Produktklarheit und -wahrheit sollten dann wieder einfacher und Green- und Impact-Washing weiter vorgebeugt werden.
Denn ein weiterer Grund der Ernüchterung bei nachhaltigen Geldanlagen sind teils falsche Erwartungshaltungen gewesen. Bei diesem Thema kommen verschiedene Anlagestile, die wiederum unterschiedliche Bedürfnisse von Anlegern ansprechen, zusammen. Grob lassen sich drei Hauptmotive für Menschen, die nachhaltig anlegen wollen, ausmachen: Rendite-Risiko-Aspekte, ethisch-moralische Werte, oft verbunden mit religiösen Anforderungen und konkrete Verbesserungen, also Impact für den Planeten und die Gesellschaft. Diese drei Motive sind nicht voneinander getrennt, sondern finden sich mehr oder weniger in den jeweiligen Anlagestilen wieder, die oft eine Kombination verschiedener Werkzeuge aus dem Baukasten nachhaltiger Geldanlagen sind.
Meines Erachtens treten wir nun in die Phase der Gesundung nach dem Hype ein und die Professionalisierung nachhaltiger Investmentansätze wird die vormals euphorisch hochschnellende, nun eingebrochene Kurve auf ein Niveau mit vernünftigeren Erwartungshaltungen bringen. Ob das der „Pfad der Erleuchtung“ des angesprochenen Gartner-Zyklus ist, wird sich zeigen und wird maßgeblich von den anstehenden Reformbemühungen der EU-Regulatorik abhängen.
Die EU-Verantwortlichen für Sustainable Finance sind nämlich lernfähig und werden ab dem Herbst unter anderem über eine Neu-Ausgestaltung der Offenlegungsverordnung diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Überlegungen zur Einführung von Produktkategorien. Neben der Tatsache, dass seit Mai dieses Jahres für alle Fonds, die ESG- oder nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Namen haben, Leitlinien der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) gelten, die mit den im Raum stehenden Produktkategorien verwoben werden könnten, drängt es sich auf, auch die MiFID-II-Nachhaltigkeitspräferenzen folgerichtig danach auszurichten. Dann könnte wieder viel mehr aus einem Guss beraten werden und der Kanal zwischen Produktherstellern und -nachfragern würde wieder funktionieren.
Denn der Vorwurf, dass hauptsächlich die gerade für den Privatkundenmarkt schlecht gemachte EU-Regulatorik Grund für das komatöse ESG-Dasein bei der Kundschaft ist, zeigt sich daran, dass es auch anders gehen kann. So wird in der Schweiz ein kontinuierlich steigendes Interesse an nachhaltigen Anlagestilen konstatiert. Dabei performen die dort vertriebenen Fonds nicht besser, die Eidgenossen leben im gleichen Zeitgeist wie wir und haben eine ähnliche Anlagekultur. Es liegt also nicht unbedingt an der nun kurzfristigen Underperformance. Denn sonst hätten im Übrigen viele aktive konventionelle Fonds auch keine Daseinsberechtigung.