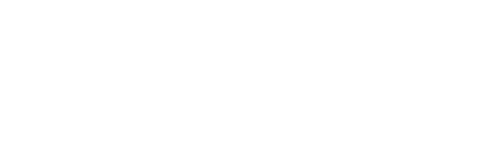Die jüngsten Inflationszahlen im Euroraum richten den Blick auf die kommende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB und die zarte Konjunkturerholung in Europa. Nach acht Zinssenkungen und einer leicht gestiegenen Inflation im Juni stellt sich die Frage nach den weiteren Weichenstellungen, betonten die Experten des Steiermärkische Sparkasse Private Banking im jüngsten Marktkommentar.
Im Juni ist die Teuerung im Euroraum laut EU-Statistikamt leicht auf zwei Prozent (Mai 1,9%) gestiegen – also exakt auf das Ziel der EZB. Die höchsten Inflationsraten verzeichneten Estland (5,2%), die Slowakei (4,6%) und Kroatien (4,4%). Am niedrigsten fiel der Preisanstieg in Zypern (0,5%), Frankreich (0,8%) und Irland (1,6%) aus. In Österreich lag die Inflation bei 3,3 Prozent.
INFLATION: NOCH NICHT ÜBERWUNDEN
Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich im Vergleich zu den Höchstständen der Jahre 2022 und 2023 deutlich abgeschwächt. Besonders die Energiepreise haben sich nach der Eskalation rund um den Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine wieder stabilisiert. Auch bei Lebensmitteln ist eine Entspannung spürbar, wenngleich viele Verbraucher:innen unter den hohen Preisen leiden.
Dennoch bleibt der Inflationsdruck in bestimmten Sektoren – etwa bei Dienstleistungen und Mieten – bestehen. Die Kerninflation, die volatile Komponenten wie Energie, Tabak, Alkohol und Lebensmittel ausklammert, liegt mit 2,3 Prozent noch immer über dem angestrebten Niveau. Somit deutet nun einiges darauf hin, dass der EZB-Rat, das Entscheidungsgremium der Notenbank, die Zinsen im Euro-Raum bei seiner Sitzung am 24. Juli nicht antasten wird. Einzelne Notenbanker hatten in den vergangenen Wochen bereits dahingehende Äußerungen gemacht. Die Juni-Inflation stärkt deren Position. Jedenfalls steht die EZB vor einer schwierigen Gratwanderung: Einerseits muss sie die Inflation eindämmen, andererseits will sie die zaghafte Konjunkturerholung nicht gefährden.
EU AM WENDEPUNKT
Die europäische Wirtschaft steht 2025 an einem Wendepunkt mit einigen positiven Signalen. Nachdem die vergangenen Jahre von pandemiebedingten Einbrüchen, Lieferkettenproblemen, dem Krieg in der Ukraine und stark schwankenden Energiepreisen geprägt waren, zeigen sich nun sowohl bei der Konjunktur als auch bei der Inflation zaghafte Hoffnungsschimmer. Allerdings: Während einige Länder eine vorsichtige Erholung verzeichnen, kämpfen andere weiterhin mit strukturellen Problemen und einer hartnäckigen Teuerung. Dämpfend wirken sich auch der Handelsstreit mit den USA und die immer noch ungelöste Frage der künftigen US-Zölle aus.
Für die Eurozone wird 2025 ein Wachstum vom 0,9 Prozent erwartet, für die EU-27 wird dieses voraussichtlich 1,1 Prozent betragen. Länder wie Spanien, Irland und Portugal profitieren vom anhaltenden Tourismusboom und einer stabilen Binnennachfrage. In Deutschland hingegen – traditionell Europas wirtschaftliches Zugpferd – bleibt die industrielle Produktion unter Druck, unter anderem wegen hoher Energiepreise und einer schwachen globalen Nachfrage nach Investitionsgütern.
VERHALTENER OPTIMISMUS
Die kommenden Monate werden entscheiden, ob Europa auf einen stabilen Wachstumspfad zurückfindet. Die Inflation ist auf dem Rückzug, aber noch nicht besiegt. Die Konjunktur zeigt Anzeichen der Erholung, bleibt jedoch fragil. Der Weg zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Stabilisierung ist steinig. Er erfordert sowohl eine konsequente Strukturpolitik auf nationaler Ebene als auch ein abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Ebene – etwa bei der Energiepolitik, der Wettbewerbsfähigkeit und der Verteidigung gegen externe wirtschaftliche Schocks. Denn neue Risiken – etwa aus China, Russland, dem Nahen Osten oder durch Extremwetterereignisse – könnten die Erholung erneut gefährden.