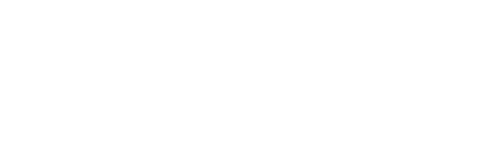Es scheint, als hätte Nachhaltigkeit den Mainstream verlassen. Auf Ebene der Europäischen Union (EU) könnten mit dem kürzlich vorgestellten „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ zahlreiche Vorgaben des von der letzten EU-Kommission beschlossenen Green Deals aufgeweicht oder schlicht gestrichen werden. Zudem sollen in den nächsten Jahren 800 Milliarden Euro für eine massive Aufrüstung mobilisiert werden, um die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents entscheidend zu stärken. Diese Entwicklungen finden auch ihren Widerhall an den Aktienmärkten, wie insbesondere der Boom zahlreicher Rüstungsaktien zeigt. Gleichwohl ist das nur die eine Seite der Medaille.
Die andere zeigt die Klimakrise. Die globale Erderwärmung nimmt ebenso unvermindert zu wie der Anstieg der Meeresspiegel. Es klingt zynisch, aber spätestens, wenn wieder eine Flutkatastrophe in unseren Gefilden massive Zerstörungen verursacht, wird diese Herausforderung auf die Agenda der Bevölkerung zurückkehren. Anders ist die Lage in der Wirtschaft. Denn Unternehmen, vor allem wenn sie international tätig sind, müssen diese Risiken längst managen. Das gilt natürlich erst recht für die Versicherungswirtschaft, die gerade mit Blick auf die Absicherung von Brand- und Elementargefahren Klimarisiken identifizieren, bewerten und kalkulieren muss. Schon deshalb verwundert es nicht, dass 70 Prozent der Versicherer ESG-Kriterien in ihre Risikobewertung einbinden (wollen), wie eine aktuelle Studie zeigt. Auch die EU-Regulatorik drängt mit Nachdruck dazu.
Defizite bei Deckungsstöcken
Differenzierter fällt der Blick auf die grünen Vorsorgewege aus, die Kunden inzwischen beschreiten können. Wer klassisch oder hybrid sparen will, um auf Kapitalgarantien nicht zu verzichten, muss weiterhin gehörige Abstriche in Kauf nehmen. Denn die Sicherungsvermögen, also die sogenannten Deckungsstöcke, mit denen diese Zusagen gewährleistet werden, sind nur zu einem mehr oder weniger großen Teil ESG-konform. So hat das Ausmaß der nachhaltigen Veranlagung natürlich mit der Anlagepolitik der Gesellschaft zu tun. Vor allem aber sehen sich die Anbieter einem langwierigen Prozess gegenüber, weil das verwaltete Vermögen nicht in wenigen Jahren komplett auf „grün“ umgestellt werden kann. Zudem erschweren regulatorische Vorgaben den Prozess.
Bei Fondspolizzen ist die Lage deutlich besser. Entscheidend ist hier der Anteil nachhaltiger Fonds in den von Versicherern angebotenen Fondspaletten. Wobei sich die Fonds ebenso stark voneinander unterscheiden wie die Vorstellungen der Kunden, was sie unter einem nachhaltigen Investment verstehen. Die Klassifizierung nach der EU-Offenlegungsverordnung hilft hier nur insofern weiter, dass sich die Artikel 6-Fonds ausschließen lassen. Ob ein Artikel 8- oder Artikel 9-Fonds aber den Vorstellungen des jeweiligen Kunden entspricht, muss letzten Endes der Berater erkunden, sofern sein Kunde das will. Das gilt auch für Fonds, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen oder dem FNG-Siegel zertifiziert wurden – allerdings mit dem Unterschied, dass diese Geldanlagen eine externe Nachhaltigkeitsprüfung bestanden haben. Inwieweit die neuen Regeln der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsicht zur Namensgebung künftig mit einem Plus an Transparenz bei der Auswahl passender Nachhaltigkeitsfonds helfen werden, bleibt abzuwarten.