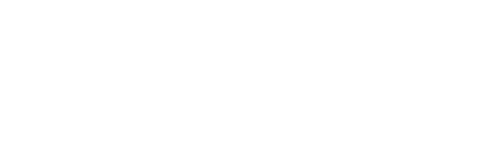Investitionen in die Artenvielfalt (Biodiversität) hinken der Klimafinanzierung hinterher. Laut BloombergNEF (BNEF) machte Biodiversität im Jahr 2024 nur ein Prozent der gesamten Verwendung von Erlösen aus Green Bonds aus. Schätzungen gehen von einer jährlichen Finanzierungslücke im hohen dreistelligen Milliardenbereich aus.
Dies liegt vor allem an einem Mangel an Investmentmöglichkeiten, betont Vincent Latour, Sustainable Investment Specialist bei Nikko Asset Management. Projekte zur Wiederherstellung von Ökosystemen oder zum Management von Schutzgebieten sind oft nicht leicht zu monetarisieren. An den öffentlichen Aktien- und Unternehmensanleihemärkten ist das direkte Engagement in Biodiversitätsprojekten begrenzt. Das Thema ist für die meisten Sektoren oft nicht finanziell relevant – abgesehen von Emittenten aus dem Bereich Wasserversorgung, Forstwirtschaft oder Agrarindustrie. Für viele Unternehmen bleibt es schwierig, Biodiversitätsprojekte zu identifizieren, die finanziell bedeutend und über Green Bonds gut finanzierbar sind. Grüne Staatsanleihen können eine entscheidende Rolle spielen.
STAATEN GUT POSITIONIERT
Staatliche Emittenten sind für die Verwaltung großer Land- und Wasserflächen verantwortlich. Sie verfügen über das Mandat, die Größe und die langfristigen Planungshorizonte. Regierungen verknüpfen solche Investitionen oft mit politischen Zielen wie Klimaanpassung, Katastrophenvorsorge, ländliche Entwicklung oder Umweltschutz. Erste Beispiele der Naturfinanzierung gibt es bereits.
Beispiele für staatliche Biodiversitätsanleihen gibt es zahlreiche. Italien hat 2021 seine erste grüne Anleihe begeben und mehr als elf Prozent der Erlöse für den Bodenschutz, Maßnahmen gegen hydrogeologische Risiken, Wasserinfrastruktur und die Finanzierung von Meeres- und Naturschutzgebieten vorgesehen. Es geht um systemische Projekte von nationaler Bedeutung – die in der Regel nicht in den Bereich grüner Unternehmensanleihen fallen.
Im Jahr 2024 emittierte Kolumbien die weltweit erste Staatsanleihe, die ausdrücklich auf Biodiversität ausgerichtet ist. Finanziert wird damit die nationale Biodiversitätsstrategie, darunter die Wiederherstellung von Ökosystemen und den Schutz der Wälder. Diese Beispiele sind jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Die meisten grünen Staatsanleihen konzentrieren sich bislang auf die Energiewende, sauberen Verkehr oder Klimaresilienz.
TRANSPARENTE MÖGLICHKEITEN
Mit dem wachsenden Interesse an Naturfinanzierungen suchen Investoren nach transparenten Möglichkeiten, Kapital in Biodiversität zu investieren. Internationale Rahmenwerke wie das Global Biodiversity Framework (verabschiedet auf der COP15) und die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) dürften als Katalysatoren wirken. Sie sollen die Messung und Berichterstattung von naturbezogenen Risiken, Abhängigkeiten und Ergebnissen verbessern und damit mehr Klarheit und Vergleichbarkeit schaffen. Emittenten können mit ihnen naturpositive Investitionen innerhalb von Green-Bond-Programmen strukturieren und einen umfassenderen Einblick in naturbezogene Finanzierungen gewähren. Für Investoren stärken sie das Vertrauen in die Integrität und Wirkung ihrer Allokationen. Sie können damit dazu beitragen, die Anzahl an investierbaren Naturprojekten zu vergrößern.
GRÜNE ZUKUNFT
Grüne Staatsanleihen sind der vielversprechendste Weg zur Finanzierung der Biodiversität. Mit ihnen lassen sich Projekte finanzieren, die über private Märkte nur schwer monetarisierbar oder skalierbar sind. Damit schließen sie eine wichtige Lücke in der Investitionslandschaft.
Italien und Kolumbien haben Biodiversität bereits mit grünen Staatsanleihen finanziert. Mit der Weiterentwicklung der Berichtsstandards und der steigenden Investorennachfrage nach naturpositiven Ergebnissen werden staatliche Emittenten eine wichtigere Rolle bei der Schließung der Finanzierungslücke im Bereich Biodiversität spielen. Und auch für Investoren, die ein transparentes, langfristiges Engagement in naturbezogenen Projekten suchen, sind grüne Staatsanleihen ein wichtiger Teil der Lösung.