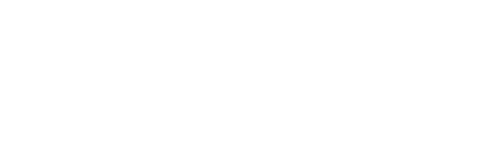FONDS exklusiv: US-Notenbankchef Jerome Powell deutete bereits im August eine Zinssenkung auf der September-Sitzung an und begründete dies mit dem schwächeren Arbeitsmarkt. Stehen die USA damit am Beginn des nächsten Lockerungszyklus?
Harald Holzer: Die Fed hatte zuletzt nur eine Pause eingelegt, das aktuelle Wirtschaftsumfeld lässt nun weitere Senkungen zu. Die Marktprognosen, gemessen am „Fed Funds Future“, liegen bei 3,5 Prozent für Ende 2026. Unsere Prognose fällt gemäßigter aus, da wir die Lage der US-Wirtschaft nicht ganz so pessimistisch einschätzen.
Erich Stadlberger: Der Lockerungszyklus wurde tatsächlich vor mehr als einem Jahr eingeläutet. Auch wir rechnen mit einigen Schritten nach unten. Dabei könnte der Leitsatz im kommenden Jahr auf bis zu 3,25 Prozent gesenkt werden, je nach US-Konjunktur. Die Arbeitsmarktdaten vom August, denen zufolge nur 22.000 neue Stellen geschaffen wurden, fielen jedenfalls schwach aus.
Helmut Siegler: Manch ein Marktbeobachter rechnet in den USA sogar mit einer Senkung auf bis zu drei Prozent. Dies halten wir zumindest aus aktueller Sicht für übertrieben. Angesichts der jüngsten Daten wird der Arbeitsmarkt weiterhin stark im Fokus stehen, zumal Anfang September auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 263.000 gegenüber den erwarteten 235.000 angestiegen sind.
Zugleich legte die US-Inflation im August um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert zu. Wie stark wird der Anstieg Powells Spielraum begrenzen?
H. H.: Der Anstieg ist teils auf die Zölle zurückzuführen, aufgrund dessen sich Importe in die USA verteuern. Powell meinte zuletzt, er sieht in dem Preisschub einen einmaligen Effekt. Der dürfte sich angesichts des sich abschwächenden Wirtschaftswachstums allmählich wieder ausgleichen.
E. S.: Wichtig ist auch anzumerken, dass der inflationäre Druck vom Dienstleistungssektor sowie von Preissteigerungen im Wohnraum kommt. Die Energiepreise bleiben in den USA hingegen relativ günstig, da die USA große Vorkommen an Öl und Gas haben. Dies verhindert, dass die Inflation noch stärker steigt und stützt zugleich die Wirtschaft.
Powells Mandat läuft im Mai 2026 aus. Sehen Sie die Gefahr, dass sein Nachfolger, der von US-Präsident Donald Trump ernannt wird, die Zinsen stärker senkt, ganz nach Trumps Wunsch?
H. S.: Ein neuer Fed-Chef muss die Wirtschafts- sowie die Inflationsentwicklung ebenso beobachten und kann die Zinsen nicht willkürlich senken. Die Notenbank riskiert andernfalls ihre Glaubwürdigkeit.
H. H.: Auf solch einen Aspekt würde obendrein der US-Bondmarkt vor allem bei längeren Laufzeiten mit weiteren Kursabschlägen reagieren, die Renditen würden im Gegenzug steigen. Damit würde sich die Neuverschuldung verteuern und Trump weiß das. Den Immobilienmarkt träfe es ebenfalls hart. Ein Großteil der Hypothekardarlehen wird auf 30 Jahre vergeben.
In der Eurozone rechnet der Markt mit keinen weiteren Senkungen, nachdem der Einlagensatz zuletzt auf zwei Prozent gesenkt wurde. Teilen Sie die Einschätzung?
E. S.: Eine finale Senkung in Höhe von 0,25 Prozentpunkten wäre möglich. Grundsätzlich dürfte aber der Zyklus beendet sein. Wir sehen inzwischen ein zartes Konjunkturpflänzchen in Europa keimen. Das umfangreiche Investitionspaket Deutschlands könnte zudem für ganz Europa einen wichtigen Impuls setzen. Schließlich handelt es sich um die größte EU-Volkswirtschaft. Jedoch wird es eine Zeit dauern, bis die positiven Effekte in der Wirtschaft sichtbar sein werden.
H. H.: Möglicherweise hat die EZB die Zinsen bereits zu stark gelockert. Denn auch die Renditen länger laufender Staatsanleihen, so zum Beispiel aus Deutschland, sind damit ein gutes Stück gesunken und mit rund 2,75 Prozent im Lichte des Zyklusendes zu niedrig. Historisch haben die zehnjährigen Renditen in solch einem Umfeld rund 1,75 Prozent über dem Leitsatz notiert.
H. S.: Auch die Inflation sollte nicht unterschätzt werden. Sie ist im August auf 2,1 Prozent leicht angestiegen. Das ist zwar nicht dramatisch. Jedoch liegen die gehandelten Inflationserwartungen laut dem US-Finanzdienstleister Bloomberg für die kommenden fünf Jahre bei jährlich 1,85 Prozent. Und das ist unserer Meinung nach zu gering, vor allem, wenn die Konjunktur wieder anziehen sollte.
Europa hat zudem ein Schuldenproblem. Gegen Österreich läuft ein EU-Defizitverfahren, in Frankreich scheiterte Ex-Premierminister François Bayrou an den Sparplänen. Wie dramatisch wird es?
H. S.: Ohne stringente Sparmaßnahmen wird Frankreich nicht auskommen, das muss die Regierung klar kommunizieren. Wie weit die Kurse französischer Staatsanleihen im aktuellen Umfeld noch sinken werden, bleibt zunächst abzuwarten. Denn
ab einem gewissen Preisniveau könnten die ersten Investoren wieder günstig zukaufen und die Kurse damit stützen.
E. S.: Tatsächlich notieren die Renditen französischer zehnjähriger Staatsanleihen inzwischen auf gleichem Niveau wie jene für italienische Staatsanleihen per Mitte September. Dabei hat letzteres Land eine schlechtere Bonitätsnote. Allerdings ist Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für italienische Verhältnisse bereits recht lange im Amt. Dies signalisiert Stabilität und wirkt sich positiv auf den Markt für italienische Staatsanleihen aus.
Wie spiegeln sich Ihre Einschätzungen insbesondere zu Inflation und Schulden in den ausgewogenen Musterportfolios aus Ihren Häusern wider?
H. S.: Euro-Staatsanleihen haben wir in unserer Anleihequote – von insgesamt knapp mehr als 46 Prozent – am höchsten gewichtet. Sie umfasst insbesondere Papiere mit hoher Bonität, so etwa aus Deutschland, Österreich und Finnland. Staatsanleihen aus Spanien und Italien haben wir für höhere Renditechancen beigemischt wie auch Inflation-Linker aus der Eurozone. Denn wie bereits erwähnt, halten wir aktuelle Inflationsprognosen für zu niedrig und sichern uns somit günstig ab.
H. H.: Auch wir wollen bei dem Thema Inflation nicht am falschen Fuß erwischt werden. Wir haben sowohl Staatsanleihen als auch inflationsindexierte Bonds aus den USA innerhalb der Anleihequote von rund 43 Prozent aufgestockt. Die Papiere beider Anlageklassen sind relativ günstig im Vergleich zu den Pendants aus der Eurozone. Gut 85 Prozent dieser US-Dollarposition sind zum Euro abgesichert, eine Entscheidung, die sich angesichts der sinkenden US-Währung als richtig herausgestellt hat. Auch aus der Eurozone haben wir sogenannte Inflationlinker beigemischt.
E. S.: Wir gehen einen anderen Weg und sind seit Längerem nicht mehr in Staatsanleihen investiert. Stattdessen setzen wir in unserem Anleiheteil von rund 42 Prozent großteils auf Euro-Unternehmensanleihen mit solider Bonität, ein wenig auch in jene aus dem Hochzinsbereich. In inflationsindexierte Anleihen sind wir ebenfalls nicht investiert, uns hat die Wertentwicklung solcher Produkte nicht überzeugt.
Sollte man Schwellenländer derzeit beimischen? Das Wachstum ist in vielen der Regionen intakt, die Währungen profitieren insbesondere vom sinkenden US-Dollar.
H. H.: Mit einer durchschnittlichen Staatsschuldenquote von rund 40 bis 60 Prozent sind viele Schwellenländer von Schuldenniveaus der Industrienationen weit entfernt. Bei Staatsanleihen aus den Emerging Markets nutzen wir Rendite- und Währungschancen, derzeit etwa beim mexikanischen Peso sowie dem südafrikanischen Rand. Doch auch solide Unternehmensanleihen sind interessant. Sie bieten höhere Renditen bei gleichem Rating wie deren Pendants aus den Industrienationen. Die Währungen sichern wir bei letzteren Positionen jedoch ab.
H. S.: In unserem Haus setzen wir den Währungsschwerpunkt vor allem auf Emerging Asien, gefolgt von Lateinamerika. Doch auch wir nutzen obendrein Chancen etwa beim südafrikanischen Rand. Die Wirtschaft ist erstaunlich resilient gegenüber den 30-prozentigen US-Zöllen, die vornehmlich die Autoindustrie und Landwirtschaft treffen. Unterstützend sind zudem die steigenden Preise für Gold- und Platin, die eine zentrale Säule der Exportwirtschaft sind.
E. S.: Wir gehen in den Schwellenländern kein Währungsrisiko ein. Bei Staatsanleihen setzen wir mittels ETFs zudem günstig auf breite Indizes. Bei den Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern bevorzugen wir hingegen aktiv verwaltete Fonds. Hier lässt sich unserer Meinung zufolge ein Mehrwert gegenüber den Indizes durch geschicktes Management erzielen.
Die Aktienmärkte steigen seit Monaten fast stetig an. In Ihren ausgewogenen Musterportfolios sind Aktien teils zu mehr als 50 Prozent gewichtet. Was steckt hinter der Zuversicht?
H. S.: Die Berichtssaison zum zweiten Quartal verlief positiv, die Unternehmen schreiben immer noch schöne Gewinne. Dabei greift Trump mit seiner jüngsten Steuerreform der US-Wirtschaft unter die Arme. Insbesondere US-Technologiefirmen profitieren hier von neuen Begünstigungen.
H. H.: Auch die niedrigeren Zinsen sind eine wichtige Stütze. Insgesamt sollten die Gewinne im kommenden Jahr weiter steigen, in Europa etwas stärker als in den USA. In Europa gibt es reichlich Aufholbedarf, wobei sich der historisch hohe Bewertungsunterschied zwischen den zwei Regionen nunmehr schließen könnte. Während Europa-Aktien in unserem Portfolio ein durchschnittliches KGV von 15 aufweisen, liegt es bei den US-Aktien im Schnitt bei 28.
E. S.: Wir gewichten Aktien derzeit mit 47 Prozent, somit neutral. Auch wir räumen europäischen Aktien derzeit das größere Potenzial ein. Die größte Gewichtung entfällt mit rund 26 Prozent aber auf US-Aktien. Zudem haben wir vergangenen Winter begonnen, US-Indexfonds beizumischen, in denen Aktien etwa im S&P 500 gleichgewichtet werden. Damit reduzieren wir die hohe Konzentration der großen US-Technologieaktien, die in den vergangenen Jahren bekanntlich eine starke Marktdominanz erreicht haben.