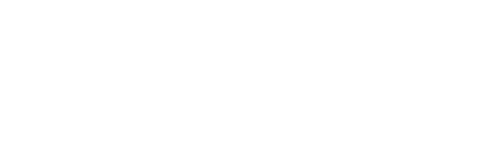Eine aktuelle Analyse des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) und des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) warnt vor weiteren wirtschaftlichen Verwerfungen durch die jüngst verhängten 15-Prozent-Zölle der USA auf EU-Importe. Laut Studie könnten die Maßnahmen zu einem Wohlstandsverlust von -0,67 Prozent in der gesamten EU führen. Für Österreich, dessen Wirtschaft auf eine starke industrielle Exportbasis und eine enge Einbindung in europäische Wertschöpfungsketten setzt, wird ein Rückgang von -0,56 Prozent prognostiziert.
Die Analyse basiert auf einem globalen Multi-Region Input-Output (MRIO)-Modell unter Verwendung der aktuellsten Daten. Dieses berücksichtigt sektorale Einkommenselastizitäten und Substituierbarkeit, erfasst direkte wie indirekte Effekte über internationale Lieferketten und bezieht auch innereuropäische Handelsverflechtungen ein. So lässt sich abschätzen, wie sich Zölle in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie Österreich verstärken können. „Österreichische Branchen gehören zu den am stärksten betroffenen. Vor allem jene mit starker Anbindung an europäische Produktionsnetzwerke und hoher Abhängigkeit von transatlantischen Exporten kommen unter Druck“, erklärt Asjad Naqvi, Senior Economist am WIFO und ASCII-Forscher. „Die Handelskonflikte wirken nicht nur auf die Endnachfrage, sondern setzen sich entlang der gesamten Wertschöpfungsketten fort. Sie schwächen Zulieferer und mindern die gesamte Wirtschaftsleistung.“
SCHLÜSSELBRANCHEN HART GETROFFEN
Aktuelle Exportzahlen zeigen unterschiedliche Abhängigkeiten von Österreichs und Europas Schlüsselbranchen vom US-Markt. In Österreich entfallen mehr als 17 Prozent der gesamten Ausfuhren in die USA auf Transportausrüstung, gefolgt von Chemikalien mit 10 Prozent und Metallprodukten mit 8 Prozent. Diese Branchen sind tief in globale Wertschöpfungsketten eingebettet – Zölle könnten daher weit über den bilateralen Handel hinaus Wirkung entfalten. Auf EU-Ebene konzentriert sich die Exportabhängigkeit auf Sektoren wie Chemikalien, Maschinenbau und Transportausrüstung. Diese Branchen können ihre Ausfuhren nur begrenzt in andere Weltregionen umleiten. Deshalb reagieren sie besonders sensibel auf die Zölle. Selbst wenn Österreich und die EU die Folgen teilweise abfedern könnten – etwa durch stärkeren Binnenkonsum oder leicht steigende Exporte in andere Regionen – würden die Zollbelastungen in mehreren Schlüsselindustrien deutlich spürbar bleiben.
Für Österreich werden die größten Wohlstandsverluste – zwischen -0,51 und -0,63 Prozent – in fünf Kernbranchen erwartet: Grundmetalle und Metallerzeugnisse, Maschinen und Anlagen, Chemikalien und Pharmazeutika, elektronische Bauteile sowie Kraftfahrzeuge und Transportausrüstung. Auf EU-Ebene dürften die höchsten relativen Verluste – zwischen -0,61 und -0,67 Prozent – in den Bereichen Transportausrüstung, Maschinenbau, Metalle und Metallerzeugnisse, elektrische und optische Geräte sowie Chemikalien anfallen. Neben den direkten, handelsbedingten Wohlstandsverlusten drohen weitere Einbußen: Investitionszurückhaltung, gestörte Lieferströme, angespannte Haushaltslagen und bereits schwächere Wachstumsaussichten dürften die Stagnation verfestigen. „Es geht hier nicht nur um Exportwerte, sondern um die strukturelle Widerstandsfähigkeit unserer Volkswirtschaften“, betont Naqvi. „Die Folgewirkungen einer Zolleskalation können ganze industrielle Ökosysteme treffen – von Arbeitsplätzen und Löhnen über die Produktivität bis hin zur Innovationskraft.“
WARNUNG VOR GEGENZÖLLEN
Während einige politische Entscheidungsträger Vergeltungszölle in Erwägung ziehen, warnt die Studie vor möglichen Rückschlägen solcher Maßnahmen. Exportabhängige Volkswirtschaften dürften sich dadurch selbst stärker schaden als dem eigentlichen Ziel. Die Ergebnisse zeigen, dass Vergeltungszölle für Länder wie Österreich, die stark auf Exporte in die USA angewiesen sind, sogar zu noch größeren Verlusten führen können. Stattdessen plädieren die Autoren für eine langfristige Diversifikation der Handelspartner, Investitionen in die Widerstandsfähigkeit der heimischen Lieferketten sowie eine stärkere Koordination innerhalb der EU, um asymmetrische Schocks besser abzufedern. Empfohlen werden strategische Weichenstellungen hin zu mehr Selbstversorgung bei wichtigen Vorleistungen sowie der Aufbau neuer Handelspartnerschaften außerhalb der traditionellen transatlantischen Achse. „Handelskriege kennen keine Gewinner. Die wirksamsten Strategien sind jene, die Resilienz stärken – nicht Vergeltung“, so Klaus Friesenbichler, stellvertretender Direktor des ASCII.
Die Studie schließt mit einem eindringlichen Appell an die EU und Österreich, einen koordinierten politischen Rahmen zu schaffen, der die Abhängigkeit von politisch sensiblen Märkten verringert. Betroffene Branchen kann man mit gezielten Förderungen unterstützen und Investitionen in kritische und strategisch wichtige Sektoren wie grüne Technologien, digitale Infrastruktur und Pharmazeutika stärken. Dazu gehören Finanzierungsmechanismen für industrielle Anpassungen, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten sowie Initiativen zur Förderung von Innovationen in besonders verletzlichen Branchen. In Zeiten wachsender globaler wirtschaftlicher Fragmentierung werden Weitsicht und Koordination entscheidend sein, um Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit in ganz Europa zu sichern. „Nur wer versteht, wie verwundbar die eigene Wirtschaft gegenüber Preis- und Versorgungsschocks ist, kann mit Resilienz und Weitblick handeln. In einer zunehmend protektionistischen Weltwirtschaft sind internationale Zusammenarbeit und faire Handelsabkommen der verlässlichste Weg zu Stabilität und nachhaltigem Wachstum“, schließt Friesenbichler.
ÜBER DIE STUDIE
Die aktuelle Studie verwendet das QUAIDS-Modell in Kombination mit dem Multi-Region Input-Output-Datensatz der Asiatischen Entwicklungsbank, um anhand von Daten aus 62 Ländern und 35 Sektoren zu analysieren, wie empfindlich Volkswirtschaften auf Preis- und Einkommensschwankungen reagieren und welche Folgen sich daraus für Handel, Produktion und Wohlstand ergeben. Es wurden die aktuellsten Daten aus dem Jahr 2023 verwendet. Der Fokus liegt auf den aktuellen globalen Handelsentwicklungen, insbesondere den bis zum 4. August 2025 verhängten US-Zöllen. Die Studie wird regelmäßig aktualisiert.