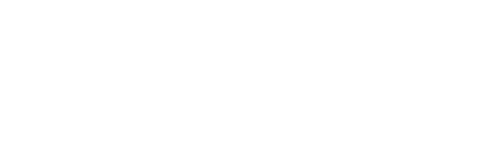Das heimische Wirtschaftsforschungsinstitut Economica hat jüngst mit Blick auf das vergangene Jahr durchaus überzeugend belegt, dass die österreichische Versicherungswirtschaft eine nennenswerte Rolle für den hiesigen Wirtschaftsstandort spielt. Ihre Bruttowertschöpfung beträgt 16,8 Milliarden Euro, was 3,9 Prozent der Wirtschaftsleistung Österreichs entspricht. Die über 186.000 Arbeitsplätze machen 3,8 Prozent der hiesigen Gesamtbeschäftigung aus. Zudem leistet die Branche mit 10,6 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben einen Beitrag von fünf Prozent zu den öffentlichen Budgets.
Mindestens genauso wichtig ist der Stabilitätsbeitrag der Versicherer. Denn die Gesellschaften sichern die Betriebsrisiken der österreichischen Unternehmen und damit auch essenzielle Risiken gerade des Mittelstands ab. Ein Brandausbruch, ein Cyber-Angriff ebenso wie ein Vermögensschaden kann Unternehmen in die Insolvenz treiben. Das gilt in zunehmendem Maße auch für Sachschäden durch Wetterextreme. So beziffert der Österreichische Versicherungsverband (VVO) die Schadenszahlungen nach dem Hochwasser im September vergangenen Jahres auf 700 Millionen Euro. Insgesamt seien Schäden aus Naturgefahren im Umfang von 1,6 Milliarden Euro geleistet worden. Nicht zu vergessen: die Pensionsvorsorge. Mit Auszahlungen von fast sieben Milliarden Euro haben die Versicherer nach Verbandsangaben die finanzielle Situation gerade mit Blick auf die Pension von Kunden unterstützt. Die wiederum haben über fünf Milliarden Euro an Prämien in ihre Lebensversicherungen eingezahlt.
Stumpfe Werkzeuge
Laut der Vorsorgestudie 2025 der Wiener Städtischen liegt der durchschnittliche Vorsorgebeitrag bei 250 Euro pro Monat. Während Männer 299 Euro investieren, sind es bei Frauen lediglich 192 Euro. Tendenz erfreulicherweise steigend. Befragt nach dem Vorsorgebetrag, den sich die Bürger maximal vorstellen könnten, gaben die Befragten im Schnitt 302 Euro im Monat an. Das zeigt, dass hier noch Potenzial drin steckt, das Berater gerade auch mit Unterstützung der Politik heben können. Die Werkzeuge gibt es längst, aber sie sind stumpf, weil sie nicht geschärft wurden.
Ganz besonders gilt dies für die betriebliche Vorsorge nach EStG Paragraf 3 (1) 15a, die laut VVO seit 50 Jahren nicht angepasst wurde. Der maximale steuerbegünstige Freibetrag dieser sogenannten Zukunftssicherung liegt immer noch bei 300 Euro pro Jahr! Nicht weniger gravierend ist die Situation bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge, die vor mehr als 20 Jahren eingeführt wurde. Bei dieser geförderten Privatvorsorge fehlt es an Flexibilität bei der Veranlagung und vor allem an einem Absenken der vollumfänglichen Kapitalgarantie, die den Versicherungsnehmern vor allem in den Niedrigzinszeiten massiv Ertragschancen gekostet hat. Die Folge: Seit rund zehn Jahren geht die Zahl der Verträge und der geleisteten Prämien zurück – während der Staat weiter finanziell fördert. Die Situation ähnelt jener bei der Riester-Rente in Deutschland. Immerhin hat die Dreier-Regierungskoalition eine Stärkung der zweiten und dritten Säule, also der betrieblichen und privaten Pensionsvorsorge, ins Regierungsprogramm geschrieben. Das lässt hoffen, dass hier endlich etwas passiert, zumal das Thema Pensionen auf der politischen Agenda angekommen ist.