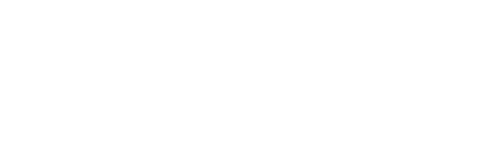FONDS exklusiv: Als neuer Obmann der Fachgruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist Ihnen besonders die Überregulierung ein Dorn im Auge. Warum?
Martin Trettler: Wenn wir uns die vielen Verordnungen anschauen, die wir umzusetzen haben, ist leider unverändert eine Tendenz zur absoluten Überregulierung erkennbar. Das merken wir in verschiedenen Bereichen unseres Tuns, angefangen bei Datenschutzbestimmungen bis hin zu Dokumentationspflichten und hier reicht der Pflichtenbogen von diversen ESG-Verpflichtungen und -abfragen bis hin zur Geldwäsche-Richtlinie. Zum großen Umfang der Regulierungsanforderungen kommt erschwerend noch das heimische Gold-Plating hinzu.
Was meinen Sie damit?
M. T.: Die EU-Verordnungen lassen gewöhnlich einen gewissen Spielraum. Der österreichische Gesetzgeber tendiert jedoch dazu, bei der Umsetzung von Regelungen ein Stück weit mehr einzufordern als eigentlich nötig ist. Und das führt zu einem erheblichen administrativen Mehraufwand. Wenn dadurch aber ein Großteil unserer Tätigkeit beansprucht wird, dann ist das alles andere als produktiv.
Wo sind die Auswirkungen in der Praxis am größten?
M. T.: An vorderster Stelle steht hier leider immer noch die KIM-Verordnung, obwohl sie per 30. Juni ausgelaufen ist. Die Finanzmarktaufsicht hat jedoch ein Rundschreiben herausgegeben, in dem Finanzinstitute aufgefordert werden, sich weiterhin unbefristet an die Richtlinien dieser Verordnung zu halten.
Was bedeutet das konkret?
M. T.: Gerade in den Zeiten erhöhter Zinsen war die Intention des Gesetzgebers, die Ausfallquoten bei der Vergabe von Immobilienkrediten zu minimieren, durchaus nachvollziehbar. Doch inzwischen liegen die tatsächlichen Daten vor und die zeigen, dass die Ausfallquoten von privaten Immobilienfinanzierungen in Österreich seit Dekaden zwischen ein und zwei Prozent liegen. Das ist kein Ergebnis der Verordnung. Denn derart niedrige Quoten hatten wir auch in der Vergangenheit. Angesichts dieser Entwicklung fordern wir gemeinsam mit der gesamten Immobilienbranche die Finanzmarktaufsicht auf, von diesen Anforderungen abzulassen.
Sie erwähnten auch die Geldwäsche-Richtlinie. Was ist hier der Stein des Anstoßes?
M. T.: Angenommen, ein Kunde geht zum Finanzdienstleister, weil er sein Depot im Umfang von 200.000 Euro überprüfen und gegebenenfalls optimieren will. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der Großteil gut veranlagt ist, einige Anlagen aber optimiert gehören. Des Weiteren wünscht der Kunde einen Depotbankwechsel. Das führt dazu, dass der Berater mit dem Kunden den gesamten Prüfprozess nochmal starten muss, obwohl er gegenüber seiner bestehenden Depotbank bereits alle Herkunftsnachweise erbracht hat. Das ist Kunden nur schwer zu vermitteln und ein Paradebeispiel für Überregulierung.
Wofür plädieren Sie stattdessen?
M. T.: Zumindest, wenn die bestehende Bankverbindung im Heimatland oder in der EU liegt, sollte auf solche neuerlichen anlassbezogenen Nachweiskontrollen verzichtet werden. Besser wäre es, die Richtlinie auf die Fälle auszurichten, wo der Verdacht einer Geldwäsche nachvollziehbar und angebracht ist. In unserem normalen Kundenverkehr findet kaum bis keine Geldwäsche statt. Ein solcher Fall ist mir in meiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit als Finanzdienstleister kein einziges Mal untergekommen. Dasselbe Bild ergibt sich, wenn ich mich hierüber mit meinen Kollegen austausche.
Auf welche Bereiche wollen Sie in Ihrer Funktion als neuer Obmann noch einen Schwerpunkt legen, Herr Trettler?
M. T.: Mir liegt das Thema Finanzbildung auch ganz persönlich am Herzen. Ich habe vier Kinder, die mittlerweile ihre Schullaufbahn beendet haben. Doch ich bin erschrocken darüber, dass sie wie viele andere trotz Reifeprüfung kaum in der Lage sind, einfache finanzielle Anforderungen des Alltags allein zu erfüllen, sei es zum Beispiel eine Arbeitnehmerveranlagung zu machen oder die Grundbegriffe einer gesetzlichen Kfz-Haftpflichtversicherung zu verstehen, obwohl sie mit dem Auto oder Moped zur Uni oder in die Lehre fahren. Hier sehe ich unsere Bildungseinrichtungen stark gefordert, in Kombination mit den politischen Entscheidungsträgern.
Was wollen Sie tun?
M. T.: Wir haben zum Thema Finanzbildung in Niederösterreich eine eigene Gruppe gebildet und uns auf die Fahnen geschrieben, aktiv insbesondere auf die höheren Schulen zuzugehen. Denn in den jetzigen Lehrplänen ist wenig Finanzbildung vorgesehen. Bisher finden nur vereinzelte Aktionen aufgrund persönlicher Initiativen statt. Wichtig wäre aber, das Thema Finanzbildung unter Einbindung der zuständigen Behörden, der Lehrkörper und Fachleuten aus der Praxis fix in den Lehrplan aufzunehmen. Denn die Maturanten ebenso wie die Mittelschüler sollten doch zumindest über ein gewisses Finanz-Basiswissen verfügen, wenn sie die Schule verlassen – auch damit sie nicht auf manche falsche Versprechungen von Finfluencern hereinfallen.
Haben Sie Beispiele?
M. T.: Na klar. Die jungen Menschen sollten aufhorchen und die Finger davon lassen, wenn Veranlagungen empfohlen werden, ohne dass die Risiken benannt oder jährliche Renditen von 30, 40, 50 und mehr Prozent versprochen werden. Hier sollte der Gesetzgeber stärker hinschauen, ob die Finfluencer im Rahmen ihrer Gewerberechtsberechtigung handeln und wie das mit etwaigen Haftungsansprüchen aussieht, wenn junge Menschen durch Betrug oder Falschberatung finanziellen Schaden erlitten haben. Denn hier dürfte die Dunkelziffer recht hoch sein, weil sich Betroffene erfahrungsgemäß häufig schon aus Scham nicht melden. Jedenfalls besteht in diesem Bereich Regulierungsbedarf, aber nicht bei den Finanzdienstleistern, die physisch vor Ort für ihre Kunden da sind.
Wichtig wäre in diesem Zusammenhang das Berufsbild Vermögensberaters zu schärfen, oder?
M. T.: Richtig, als Interessensvertreter versuchen wir natürlich das Image des Finanzberaters als Experten zu schärfen. Aber ich bin jetzt wie gesagt schon sehr lange in der Branche tätig und muss zurückblickend wirklich feststellen, dass sich das Berufsbild stark zum Positiven gewandelt hat. Ich kenne nahezu keinen, bei dem ich nicht zu 100 Prozent gegenüber Kunden sagen würde, hier sind Sie gut aufgehoben, denn der Kollege kann Sie objektiv beraten, weil er ungebunden von Produktgebern tätig ist. Das ist ja das Geheimnis jeden erfolgreichen Finanzberaters, aber das muss beim Gesetzgeber und Konsumentenschutz erst einmal ankommen.
Wie meinen Sie das, Herr Trettler?
M. T.: Wir verdienen auf Basis von Honoraren oder bei Vermittlung von Finanzverträgen. Das ist natürlich die kurzfristige Betrachtung. Langfristig ist jede erfolgreiche Geschäftsbeziehung darauf aufgebaut, dass der Kundennutzen an oberster Stelle steht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nur ein zufriedener Kunde auch weiterhin bereit ist, sich betreuen und beraten zu lassen. Das Leben ist bekanntlich ein dynamischer Prozess, bei dem es immer wieder Veränderungen gibt. Und nur ein zufriedener Kunde lässt sich über Jahre hinweg vom Berater begleiten. Dann ist es begeisternd, wenn Kunden einem die Finanzberatung ihrer Kinder anvertrauen. Kurzum, eine hohe Anzahl zufriedener Kunden – das ist der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg und dieses Credo ist in unserer Branche heute absolut angekommen!